Amelie Fried kannte ich vor ihrem Roman Die Spur des Schweigens nicht. Dieses Buch ist das erste und einzige, das ich von ihr las; ich konnte es mir also unvoreingenommen zu Gemüte führen. Der Klappentext klang vielversprechend: Me-too-Debatte, sexuelle Übergriffe, ein Selbstmord, ein verschwundener Bruder und all das im wissenschaftlichen Milieu. Der Stoff bietet mutmaßlichen Zunder.
Die Spur des Schweigens
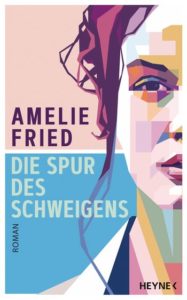
Julia Feldmann ist eine vierzigjährige, alleinstehende Frau. Ihr Vater, der stets namenlos bleibt, ist an Krebs gestorben. Ihre Mutter Gitta lebt allein und verliert so langsam ihr Gedächtnis. Zwölf Jahre zuvor ist Julias Bruder Robert auf einer Norwegenreise verschollen gegangen. Von seiner Leiche gibt es seither keine Spur.
Als freie Journalistin hält sich Julia mühsam mit Artikeln zu medizinischen Themen über Wasser. Ihr Hauptauftraggeber ist Christopher Hensel – ein Freund aus der Journalistenschule und heutiger Chefredakteur von Gesundheit heute. Im Sinne des Selbsterfahrungsjournalismus testet sie verschiedene Abnehm- und Schönheitsprodukte und macht auch New-Age-Veranstaltungen mit. Dieser banalen Stories müde, bittet sie Chris um eine richtige Story. Er gibt ihr einen Hinweis. In einem renommierten Forschungsinstitut soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein.
Julia hält eigentlich nichts von der Me-too-Debatte und steht dem Ganzen eher kritisch gegenüber. Doch sie beginnt ihre Recherchen und deckt immer mehr Machtmissbrauch, Schweigen und Vertuschungen auf. Auch ihr Bruder scheint in irgendeiner Weise darin verwickelt gewesen zu sein.
Beziehungsgestörte Heldin
Die Heldin Julia hat es schon nicht so leicht. Sie hat den Verlust des Bruders nie richtig verkraftet. Ihr Beziehungsleben ist nicht wirklich von Erfolg gekrönt, denn meist trennt sie sich, bevor der andere sich trennen könnte. Zudem greift sie gerne zum Alkohol, der zu ihrer ungesunden Ernährungsweise und ihren nicht vorhandenen Tagesablauf sein Übriges beiträgt. Zudem wird ihre Mutter dement
Ihre besten Freundinnen – Nina und Kathrin – haben ihr einen Salsa-Kurs geschenkt. Nun muss sie auch daran noch teilnehmen und sich den Tanzlehrer Jorge und sein Gerede über Salsa und Liebe antun. Aber nach jedem Kurstermin gehen die Mädels ins italienische Restaurant Da Gino und lassen ihre Abende dort ausklingen. Nina ist in einer Beziehung mit dem »langweiligen« Lehrer Felix; sie schaut und flirtet aber auch gern woanders. Kathrin ist alleinerziehende Mutter, die ihr Mann sitzen lassen hat, denn er hat sich nicht von ihr angezogen gefühlt.
Noch vor ihren Recherchen lernt Julia den gut aussehenden Fernsehmoderator Sebastian Bayer kennen. Sein Kameramann tritt ihr versehentlich auf den Fuß und Sebastian trägt sie dann heldenhaft huckepack davon zur Hotelbar. Er gefällt ihr, aber Julia fällt in ihr altes Muster. Zwar verabredet sie sich mit ihm und sie landen im Bett, danach stößt sie ihn aber von sich.
Opfer und Opfer bringen
Doch das scheinbare Hauptthema sind Julias Recherchen zu sexuellen Übergriffen am Johannes-Löwe-Institut, wo auch ihr Bruder gearbeitet hat. Ihre erste Spur erhält sie von der Wissenschaftlerin Dr. Ariane Hildebrandt, die nicht mehr als versteckte Hinweise geben kann. Sie geht dorthin und forscht investigativ nach. Sie bleibt aber nicht unentdeckt. Die chinesischstämmige Doktorandin Shenmi nimmt Kontakt zu ihr auf und beliefert sie fortan mit Informationen und treibt noch weitere Opfer auf. Der Verdächtige: PostDoc Dr. Jens Höger.
Aber auch der Leiter des Instituts – Prof. Dr. Carl-Friedrich Dettmer – steht in Verdacht, die Taten seines Sprösslings zu vertuschen und zudem wissenschaftliche Ergebnisse seiner Doktorandinnen zu stehlen und selbst zu verwerten.
Während sie Dettmer direkt konfrontiert, spielt sie mit Höger eine Art Spiel. Sie verkalkuliert sich jedoch, trinkt in einer Bar viel zu viel und landet mit ihm im Bett, ohne zu wissen, dass er das Ganze gefilmt hat. Julia macht sich dadurch erpressbar. Darüber hinaus musste auch noch Sebastian sie zusammen mit Höger in dieser Bar sehen, wie sie um Högers Hals hängt.
Aber sie schafft es, einige Opfer zu finden und ihre Geschichten aufzuschreiben. Die Story ist allerdings zu groß für Gesundheit heute. Sie wendet sich also an spektrum. Dort kauft man ihr die Story für 18.000 Euro ab. Sie wird gedruckt. Höger macht seine Warnung wahr und veröffentlicht das Sex-Video.
Es folgt ein anstrengender Prozess – für sie und für die Opfer. Dettmer wird freigesprochen. Höger wird zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe ohne Bewährung und zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt. Für ihre investigative Story gewinnt Julia den Deutschen Journalistenpreis in der Sparte Wissenschaftsreportage und letztlich rauft sie sich mit Sebastian zusammen und versucht, Liebe einfach zuzulassen.
Der verlorene Sohn
Daneben gibt es noch einen weiteren Erzählstrang, der sich mit Julias Bruder Robert und seinem Verschwinden beschäftigt. Dieser Erzählstrang fungiert als Flashback. Er beginnt mit dem Tag des Verschwindens und wie Julia zu ihren Eltern fahren und der Polizei Informationen zu ihrem Bruder geben muss. Man geht von einem Unfall aus, hält aber auch einen Suizid für möglich. Seine Leiche wird jedenfalls nicht gefunden.
Danach führt der Flashback über Kindheitserinnerungen zur Gegenwart. Robert fühlt sich, als stünde er immer im Schatten seiner großen Schwester. Das Abitur schafft er wegen seiner Prüfungsangst nicht. Eigentlich soll er wie sein Vater Medizin studieren und Arzt werden. Sein Vater ist enttäuscht und Robert kommt sich wie ein Versager vor. »Bei euch gibts Liebe nur gegen Leistung« (S. 63)
Danach bricht er mit seiner Familie. Er macht eine Ausbildung und arbeitet im Johannes-Löwe-Institut als BTA. Dort lernt er die chinesische Doktorandin Yenma kennen und sie verlieben sich. Es ist seine erste Beziehung. Doch Yenma wendet sich plötzlich von ihm ab. Sie möchte nicht mehr mit ihm schlafen. Aber sie möchte ihn trotzdem heiraten, damit er sie immer beschützen kann. Dann sieht er sie jedoch, wie Höger sie angrapscht und im Fahrstuhl küsst. Für Robert ist klar, dass sie etwas mit Höger hat, und er trennt sich von ihr.
Wenig später bringt sich Yenma um. Erst jetzt realisiert Robert, dass Höger sie missbraucht hat. Robert ist zu feige, etwas zu tun. Er plant seinen eigenen Selbstmord in Norwegen. Aber er kann es nicht durchziehen. Er setzt sich dann in Spanien ab und lebt dort unentdeckt zwölf Jahre lang. Bis Julia ihn mithilfe eines Detektivs findet.
Der ganze Roman ist seelenlos
Nun, was taugt dieses Buch? Im Grunde genommen, nichts. Formal betrachtet, wirkt er ganz spannend. Der Plot ist gut durchdacht. In der Theorie hat er schon seine Reize. Die Aufspaltung in zwei Erzählstränge, also in die beiden Geschichten von Julia und Robert, die dann zusammenlaufen, ist ganz nett. Die Geschichte von Julia steht dabei im typischen Erzähltempus, also im Präteritum, und die Geschichte von Robert steht im Präsens. Der Flashback wirkt dadurch auch wie ein Flashback, der die Vergangenheit zur Gegenwart macht.
Allerdings bleibt jede Figur nur ein oberflächliches Konstrukt. Nicht eine einzige Figur hat eine gedankliche oder gar emotionale Tiefe. Sie lassen sich alle nicht greifen. Ohne ihre Biografien wären sie alle gleich. Fried kann keine Gefühle erzählen. Sie kann keinen Schmerz, kein Leid, keine Trauer erzählerisch darstellen. Bei ihr wird alles zu einer emotionalen Pampe.
Man könnte sagen: Ja, ja, die Opfer der sexuellen Übergriffe können doch gar nicht ihre Gefühle nach außen zeigen. Sie schämen sich. Sie trauen sich nicht. Aber gerade da hätte Fried ansetzen müssen. Es braucht den Kontrast! Auch wenn sie nach außen nichts zeigen, werden sie doch innerlich zerbersten. Was macht es mit einer Frau, die sexuell belästigt, vergewaltigt wurde? Was fühlt sie? Fühlt sie Ekel? Gegen sich selbst? Gegen den Täter? Wie wird sie davon zerfressen?
Aber nichts dergleichen. Frieds Roman neigt dazu, reine Mitteilungsprosa zu sein. Keine Figur, kein Ort, keine Situation, nichts wird plastisch. Absolut gar nichts wird erzählerisch dargestellt. Alle Orte sind Nicht-Orte. Selbst in Spanien ist nichts spanisch. Sie sieht aufs Meer. Der Sonnenuntergang ist spektakulär. Es gibt keine Gerüche, keine Geräusche, keine Farben. Der ganze Roman ist seelenlos. Nichts ist lebendig. Es gibt keine einzige lebendige Figur. Es gibt gar nichts. Und hier folgt eine kleine Ausnahme: Robert. Allein bei Roberts eigener Geschichte, die im Buch kursiv gesetzt ist, habe ich den Eindruck, dass Fried doch etwas die Oberfläche des Gefühls ankratzen kann.
Noch blöder kann man sich das nicht ausdenken
Oberflächlich, kitschig, klischeehaft, inhaltsleer. Das sind die passenden Stichwörter für zu viele Episoden in diesem Roman. Die Mädelsrunde zwischen Julia, Nina und Kathrin, die immer nach dem Salsa-Tanzkurs im italienischen Restaurant Da Gino essen und über ihre kläglichen Beziehungen und ihren faden Alltag reden, hat schon etwas von einem schwachen Abklatsch von Sex and the City.
Hier hatte mich die Autorin fast. Für einen gewissen Moment dachte ich: Aha! Sie stellt das alles realistisch dar und nimmt jeden aufs Korn. Vor allem mit Julias scheinbarer Stimme der Vernunft, die nichts vom heißen Latino Jorge und seinem sexistischen Salsa-Gelaber hält, dem die Frauen so verfallen. Aber der Schein trügt. Fried packt noch mehr Klischees aus. Nina verliebt sich in Karim – einen Kurden –, der ihr verheimlicht, dass er eine Frau und zwei Kinder hat. Nun gesteht sie es ihrem eigentlichen Partner Felix, der überglücklich wird, da er seine eigene Affäre nicht mehr verheimlichen muss und sich endlich trennen kann. Dumm gelaufen!
Überhaupt hat sich Fried gehaltloser und stumpfsinniger Motive bedient. Natürlich muss Julia mit dem Hauptverdächtigen im Bett landen (alkoholisiert, versteht sich). Und natürlich muss er das gefilmt haben, um sie erpressbar zu machen. Es dient ja schließlich zur Veranschaulichung des Machtmissbrauchs. Julia wirkt doch wie ein Aschenputtel. Sie hält sich mit sinnlosen Artikeln über Wasser. Ihr Wert wird nicht geschätzt. Ihr Chef behandelt sie machohaft von oben herab. Zu guter Letzt bekommt sie ihren Traumprinzen Sebastian, den sie fast vergrault hat, landet mit ihrer Story einen Erfolg und bekommt sogar noch den Deutschen Journalistenpreis in der Sparte Wissenschaftsreportage. Noch blöder kann man sich das nicht ausdenken.
Ihre Sprache ist ohne Zauber
Zudem mag ich das nicht, wenn ich beim Lesen genau weiß, was als nächstes passiert oder wie eine Geschichte gar enden wird. Positiv gedeutet, bin ich wohl ein intuitiver Leser, der eine Verbindung zur Autorin und zu ihrem Buch hat. Negativ gedeutet, bedient sich die Autorin abgedroschener und banaler Motive, sodass alles erwartbar wird.
Und trotz alledem habe ich das Buch nicht verkrampft gelesen. Es liest sich sogar recht flott. Ich habe das gern, wenn jemand gut schreiben kann. Irgendwie scheint es so, als ob Fried Die 50 Werkzeuge für gutes Schreiben von Roy Peter Clark gelesen hätte. Alle Tipps, die solche Schreibratgeber mitgeben, finden sich in Frieds Buch umgesetzt. Dadurch liest es sich gut, wirkt aber stillos. Ihre Sprache ist ohne Zauber. Sie kennt keine Poesie. Nicht einen Satz, nicht einen Ausdruck habe ich mir markieren können, da alles gleich, alles banal klingt.
Kläglicher Unterhaltungsroman
Der Roman hat letztlich nichts mit hoher Literatur zu tun. Mir scheint, hier hat sich ein Trivialroman das Kleid eines wichtigen gesellschaftlichen Themas angezogen. Und das war’s. Bei diesem Thema hatte ich mir mehr erhofft. Ich will mehr Literatur zu #MeToo! Ich will, dass sie laut ist! Sie soll so laut sein, dass es den Verweigerern auf die Nerven geht! Und ich bin mir sicher, dass dieser Roman kommen wird. Fried hat ihn hingegen nicht abgeliefert.
Anmerkungen zum Satz: Roberts Szenen wurden kursiv gestaltet. Das ist eine nette Idee, aber ungünstig. Hervorhebungen werden dann im normalen Schriftschnitt gesetzt. Die Wirkung ist allerdings nicht dieselbe, wie das Kursivsetzen im normalen Text. Die Hervorhebungen lassen sich schlichtweg nicht wahrnehmen. Zudem verstehe ich die Logik nicht, Seitenzahlen auf der rechten Seite konsequent links zu setzen. Wer schaut denn bitte im Inneren des Buches nach?
Informationen zum Buch und zum Verlag
Verlag: Heyne Verlag
Hardcover mit Schutzumschlag, 496 Seiten, 22,00 €
ISBN: 978–3‑453–27048‑0
Das Buch wurde mir freundlicherweise vom Bloggerportal und dem Heyne Verlag zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!

